Katja Lindenmann
Redaktion: Tiziana Bonetti, Rachel Huber, Zoé Kergomard
Wer sich für wenig erforschte Themen interessiert, kennt die Situation: Nach langer Recherche sitzt man vor den mit viel Aufwand gefundenen Büchern und hofft, dass die Forschungstexte das eigene Wissen ergänzen und sowohl inhaltliche als auch methodische Inputs bieten. Was aber, wenn sie dies nicht tun?
Mir ging es letztens genauso bei einem medizinhistorischen Thema. Ich recherchierte zur frühneuzeitlichen Geburtshilfe und stiess mit der überschaubaren Literatur, die ich fand, an Grenzen: Häufig wurden Quellen darin nicht ausreichend historisch-kritisch ausgewertet und stattdessen historische Narrative reproduziert. Konkret waren dies misogyne Narrative, die aus einem stark binären Geschlechtersystem heraus argumentierten. Ich fragte mich: Wie gehe ich damit um? – Und kann ich als queerfeministische Forscherin damit überhaupt arbeiten?
Bevor ich aushole und meine Erfahrungen detaillierter schildere, sei vorweggenommen, dass ich am Ende einen Umgang mit den Texten gefunden habe, um den ich froh bin. Denn die Herausforderung, mit wenig erforschten Themen zu arbeiten, lohnt sich. Und das nicht zuletzt, weil man sich dabei besonders intensiv mit dem Forschungsfeld auseinandersetzen muss. Dies aus einer queerfeministischen Perspektive zu tun, sehe ich als Notwendigkeit an. Ich positioniere mich als Forschende umfassend queerfeministisch, weil ich nur aus einer solchen Position heraus die Möglichkeit sehe, Quellen konsequent zu historisieren. Dies, da nur ein antipatriarchaler, nicht binär orientierter Blick auf Quellen – und Forschungstexte – ein multiperspektivisches Verständnis derer ermöglicht. Mir ist es wichtig, hier anzumerken, dass meine Forschungsperspektive gezwungenermassen von dem patriarchalen und heteronormativen Gesellschaftssystem geprägt ist, in dem ich sozialisiert bin. Wenn ich nun queerfeministisch arbeiten will, geht es also um ein Bewusstsein darüber und einen Versuch, dieses System auszuloten und zu diversifizieren. Es gibt kein Ausserhalb des mich umgebenden Gesellschaftssystems, aus dem heraus ich historisch arbeite, aber es gibt Möglichkeiten, die Grenzen dieses Systems zu hinterfragen und zu öffnen.
Also von vorn: Ich hatte mich im Rahmen eines Masterseminars dafür entschieden, einen Fall von 1725 aus den Zürcher Gerichtsakten – den Kundschaften und Nachgängen – zu bearbeiten. Es ging darin um eine zerstückelnde Operation an einem Embryo im Körper einer Frau, eine sogenannte Embryotomie. Dem Fötus wurde von einem Chirurgen beide Arme abgetrennt und das Körperchen schliesslich mit einem Haken herausgezogen. Auch die Frau überlebte nicht. Sie verstarb am Tag darauf und der Chirurg geriet in eine gerichtliche Untersuchung. Mich interessierte, was genau dem Chirurgen vorgeworfen wurde. Am Ende der Arbeit stand fest, dass die Obrigkeit den operativen Eingriff des Chirurgen als Gewalttat verstand. Allerdings nicht als Gewalttat im Sinne der Tötung von Mutter und Kind durch den Eingriff. Das verwarfen sie aufgrund des Verhörs und des vorliegenden Obduktionsberichts beider Leichen. Es schien ihnen um den Eingriff per se zu gehen, den sie als gewalttätig empfanden. Ich schloss meine Untersuchung damit, dass in diesem Fall sowie in der historischen Gewaltforschung insgesamt – und damit schliesse ich mich Forschenden wie Francisca Loetz oder Gerd Schwerhoff an – eine konsequente Historisierung nur möglich ist, wenn Gewalt ein dynamischer Begriff bleibt, der weit über physische Gewalt hinausgehen kann.[1] In meiner Untersuchung bedeutete das konkret, dass die Obrigkeit die Embryotomie wohl aus kulturellen Gründen ablehnte, obwohl sie als Eingriff weit verbreitet und anerkannt war. Und so kam der Chirurg am Ende mit einer Ermahnung davon.
Und damit zurück zu meinem Problem mit der Literatur, das ganz am Anfang der Arbeit stand: Zur Embryotomie gibt es kaum Literatur. Daher fokussierte ich meine Recherche auf die frühneuzeitliche Geburtshilfe insgesamt, um herauszufinden, inwiefern die Embryotomie um 1700 verbreitet war, wie sie bewertet wurde, wer sie durchführen durfte und wie sie im Zeitverständnis korrekt vorzunehmen war. Zur Geburtshilfe gibt es einige umfangreiche, medizinhistorische Übersichtswerke. Diese schildern die Entwicklung der Geburtshilfe meistens als Erfolgsgeschichte der Ärzte, die den ungebildeten Hebammen das Handwerk nach und nach abnahmen. Ein solches Narrativ fand ich besonders deutlich bei Edward Shorter (1984) und Erwin Ackerknecht (1974).[2] Wer jetzt die Stirn runzelt, ahnt mein Problem und muss sich für den nächsten Abschnitt vielleicht einen Schluck Wein gönnen.
In den Texten fand ich nämlich stark abwertende Beschreibungen des Hebammenwesens, die die Quellensprache reproduzierten. So schreibt Ackerknecht:
Im allgemeinen scheinen sich die Hebammen weit bis ins 17. Jahrhundert hinein auf einem sehr niedrigen Niveau befunden zu haben, obwohl sie auch zu gerichtlichen Untersuchungen beigezogen wurden. Immer wieder werden sie (mit Beispielen) als roh und abergläubisch und mit wenig Kenntnissen ausgestattet geschildert. Besonders gefährlich scheint ihre Hyperaktivität gewesen zu sein. Auch der Alkoholismus scheint unter ihnen weit verbreitet gewesen zu sein. (Ackerknecht 1974, S. 186.)
Das Zitat macht deutlich, dass Ackerknecht hier Vokabular aus Quellentexten schlichtweg übernimmt und es nicht historisiert oder kritisch auswertet. Er lässt aussen vor, dass die Quellentexte wohl ausschliesslich von Männern – und hier insbesondere von Medizinern, die in direkter Konkurrenz zu den Hebammen standen – verfasst wurden. Er verwendet die Darstellungen aus den Quellen als Belege für das «niedrige Niveau» der Hebammen. Erst mit der männlichen Geburtshilfe, hob sich dieses seiner Ansicht nach:
Die nun einsetzende wissenschaftliche Hebung des Hebammenstandes erfolgte indirekt. Es waren Männer, zuerst vor allem Barbierchirurgen, welche nun begannen, eine bessere Geburtshilfe zu entwickeln, und welche dann an die Hebammen, die bis dahin sich nur gegenseitig mit einigen empirischen Daten und abergläubischen Bräuchen belehrt hatten, ihr neues theoretisches und praktisches Wissen weitergaben. (ebd.)
Die Verbesserung des Hebammenstandes bedingte ihm zufolge also dessen faktische Untergrabung. Doch Ackerknecht ist nicht der Einzige, der die Quellentexte zu wenig reflektiert. Shorter geht sogar noch weiter. Er schreibt von einem «Geburtshilfe-Horrorkabinett», von «Stümperhaftigkeit» und einem «Gemetzel», das die Hebammen hinterlassen hätten.[3]
Mir wurde bei der Lektüre nach und nach klar, dass ich diese beiden Texte nicht einfach weglegen wollte, sondern eine intensive Auseinandersetzung mit ihnen notwendig war. Davon konnte ich letztlich profitieren. Denn, um zu verstehen, was mich genau an den Texten irritiert, musste ich mir erneut klar machen, was mein eigener Anspruch an historische Forschung ist.
Das Hauptproblem war die fehlende Historisierung von Begriffen in den Forschungstexten. Diese ist für die historische Forschung jedoch zentral und gleichzeitig auch die mitunter grösste Herausforderung. Wenn Quellensprache unzureichend historisiert wird, dann zeigt sich das auch in der Sprache der entsprechenden Forschung: Dann reproduzieren Forschende historische Narrative, statt sie herauszuarbeiten, als solche zu benennen und zu diskutieren. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass die Sprache in Forschungstexten ein Indikator für reproduzierte Narrative sein kann.
Nun, was habe ich also am Ende mit den beiden Texten gemacht? – Ich habe sie nicht als Belege für meine Forschung genutzt, sondern in mein Kapitel zum Forschungsstand eingearbeitet. Eine queerfeministische Dikussion dieser Texte bedeutet eine Kritik an heteropatriarchaler historischer Forschung und macht deren Vorgehen transparent. Damit wird diese Lesart nicht nur als misogyn entlarvt, sondern auch als grundsätzlich mangelhaft in Bezug auf den Anspruch einer konsequent historisierenden Geschichtswissenschaft. Dies bedeutet also, dass auch solche Texte − und das nehme ich grundsätzlich von dieser Erfahrung mit – unbedingt Eingang in historische Forschung aus queerfeministischer Perspektive finden müssen, da sie zum Forschungsdiskurs gehören und ihr Ausschluss eine nötige Auseinandersetzung verhindert. Nur wenn ich diese Texte aus queerfeministischer Perspektive lese und in meiner Arbeit diskutiere, kann ich deren Methode und die damit verbreiteten Narrative problematisieren. Und nur so kann sich das Forschungsfeld und ich mich als Forscherin weiterentwickeln.
[1] So bspw. in Loetz, Francisca: Sexualisierte Gewalt 1500–1850. Plädoyer für eine historische Gewaltforschung, Frankfurt a. M. 2012 (Campus Historische Studien 68). Oder bei Schwerhoff, Gerd: Historische Kriminalitätsforschung, Frankfurt a. M 2011 (Historische Einführungen 9). [→ zurück zum Text]
[2] Shorter, Edward: Der weibliche Körper als Schicksal, übers. von Hainer Kober, München 1984; Ackerknecht, Erwin H.: Zur Geschichte der Hebammen, in: Gesnerus 31 (3–4), 1974, S. 181–192. [→ zurück zum Text]
[3] Shorter 1984, S. 108. [→ zurück zum Text]


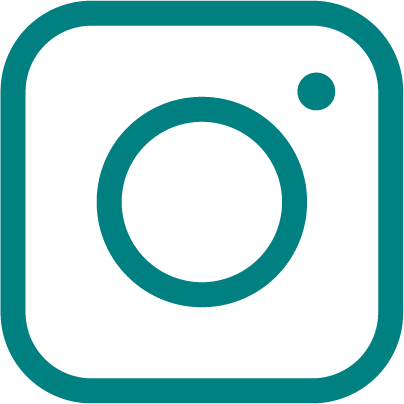

Liebe Katja
ich wollte deinen Beitrag nur kurz anschauen – und bin dann hängen geblieben, bis ich ihn ganz und gar gelesen hatte. Deine Überlegungen und dein Ringen mit der Literatur sind absolut nachvollziehbar für mich und ich kenne beides auch! Wer hat etwas wann gesagt, resp. geschrieben, aus welcher Perspektive etc. ist ein endloses Differenzieren, das neue Fragen eröffnet – etwas unheimlich Wertvolles. Natürlich kann dies nicht bei den «Quellentexten» aufhören, sondern umfasst auch die Auslegungsliteratur. Bei mir stellte sich die Frage, was das heisst, dass das Gericht die Embryotomie des Chirurgen «kulturell» nicht akzeptierte. War der Chirurg evtl. wirklich ein Grobian? War er ein Stümper, der noch viel zu lernen hatte? Was hätten denn die Hebammen dieser Zeit in diesem schwierigen Fall getan – gibt es da Fälle, die man gegenüberstellen könnte? Du siehst, ich beginne grad mitzudenken und möchte mehr wissen….
Liebe Katja Lindenmann,
Vielen Dank für diesen spannenden Beitrag! Ich bin gerade im Rechercheprozess meiner Bachelorarbeit – also meiner ersten kleineren Forschungsarbeit – und sehe mich mit ähnlichen Situationen konfrontiert.
Im Fall der Hebammen ist es sicherlich sehr geschickt, und meiner Meinung nach sogar unerlässlich, diesen Sachverhalt aus einer queerfeministischen Perspektive zu lesen, da ja allein in den Literaturausschnitten dieses Beitrags die wiedergegebene Dichotomie und Hierarchie zwischen den Geschlechtern kaum zu übersehen sind.
Aus kaum vorhandener Literatur und wenig Quellen, wie jetzt auch in meinem Fall, historisch kontextualisierte und kritische Aussagen und Folgerungen zu generieren, scheint für mich nach wie vor eine grosse Herausforderung zu sein. Eine queeferministische Lesart zur Durchbrechung von patriarchalen Narrativen stellt jedoch im Hebammen-Fall ein geeignetes «Tool» dazu dar. Ich frage mich, welche weiteren Tools sich als hilfreich erweisen, aus anderen historischen Kontexten, Epochen und Sachverhalten neue Erkenntnisse zu ziehen?
Liebe Michelle Schatzmann
Vielen Dank für den Kommentar und die weiterführenden Überlegungen.